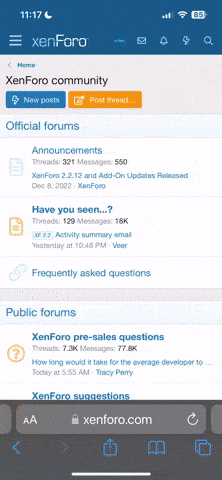B
Baihu
Guest
Eins meiner momentanen Projekte ist ein Roman zu Baphomets Fluch. Hier schonmal so die ersten Seiten der ersten Rohfassung. So weit bin ich momentan. Würd mich sehr über Feedback freuen, auch wenns die Rohfassung ist.
Paris im Herbst.
Die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends.
Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden.
Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe... und an Tod.
Ich saß in einem kleinen Café, mitten in Paris und genoss den Ausblick auf den Eiffelturm.
Die Bäume entließen ihre rotgoldenen Blätter in den Herbsthimmel, ein echtes Postkartenbild.
Ein anderes Postkartenbild war die Kellnerin des Cafés, eine junge, blondhaarige Französin, die mir eine Tasse Kaffee brachte, die endlich einmal eine ordentliche Größe hatte.
In den meisten Cafés in Paris bekommt man nur einen Fingerhut mit zwei Tröpfchen Kaffee darin. Das junge Fräulein stellte den Kaffee samt Untertasse auf den runden Tisch, aus dessen Mitte ein Sonnenschirm in denselben Farben der Marquise des Cafés ragte, blau und gelb.
Die Bedienung hatte einen roten Mini an, um die Hüften eine Schürze geschwungen, die ihre natürliche Weiße behalten hatte. Das strohblonde Haar der Französin wurde von einem Haarreifen gebändigt, der dieselbe Farbe wie ihr Kleid und ihre Stöckelschuhe hatte.
Ich strich mir durch mein engelsblondes Haar und lächelte ihr auf meine charmante kalifornische Art zu und sie erwiderte das Lächeln ohne ein Wort zu sagen, ich wusste nicht wie gut ihr Englisch war, ich wusste nur das es um mein Französisch schlecht aussah, doch das war in diesem Frankreichurlaub bisher noch kein Problem gewesen, da eigentlich jeder ein wenig Englisch konnte. Die großen, aquamarinfarbenen Augen der Kellnerin strahlten mir entgegen, doch abgelenkt durch mich rannte sie frontal in einen älteren Herrn mit grauem Hut und Trenchcoat, der ins Café wollte. Der Mann, dessen ergraute Haare unter dem Hut vorlugten, hatte eine Brille auf und trug einen braunen Aktenkoffer bei sich.
Das Mädchen erschrak, doch der Mann zupfte an seinem Hut und nickte ihr freundlich zu.
Die Kellnerin schenkte nun dem alten Herrn ein bezauberndes Lächeln.
Ich steckte mir derweil einen Zahnstocher, den ich mir im Hotel in die Tasche gesteckt hatte, in den Mund und kaute darauf. Ich fragte mich, ob das Mädchen immer so schnell war mit dem Verteilen von eindeutigen Blickkontakten. Der Mann schenkte auch mir ein kurzes, nicht ganz so offenes Nicken und die beiden begaben sich in das Café.
Wahrscheinlich nur Touristen wie ich sitzen auf dem Bürgersteig, im Herbst.
Ich überlegte mir, mich auch ins Café zu setzen, als etwas Buntes in mein Blickfeld trat.
Es waren Luftballons, blaue, rote und gelbe, alle mit dem gleichen penetranten, grinsenden Gesicht versehen. Ich reagierte mich ein wenig ab, indem ich einen der Ballons mit meinem Zahnstocher zum platzen brachte, doch das hielt die anderen Ballons leider nicht davon ab, weiter zu grinsen wie eine Horde Honigkuchenpferde.
Als der Ballon in Fetzen zerplatzte, äugte mich dahinter ein genauso impertinentes Grienen an. Ein Clown! Ich hasse Clowns und Pantomimen. Wer mir erzählt, dass die Späße dieser Scharlatane vom Dienst einen humoristischen Wert haben, den würde ich einfach mal als dümmlich bezeichnen.
Dieser Clown, der mir vor dem Café entgegenfeixte war ein komplettes Packet an Clownerie.
Auf dem völlig geschminkten Kopf thronte ein überdimensional kleiner Hut. An den Hinterkopf hatte sich der Spaßvogel die typischen, roten Clownhaare geklebt, die an beiden Seiten seines Schädels hervorsprossen. Seine buschigen Augenbrauen waren gelbblau angemalt und sein Mund mit roter Farbe umrandet, die sein Grinsen noch verzerrter wirken ließ. Das Prunkstück seiner Fratze war das, was keinem Angehörigen dieser Spaßfraktion fehlen durfte, die legendäre rote Nase. Ein runder, knallroter Ball, mitten im Gesicht dieses Amateurschelms. Doch die Farbenprächtigkeit belief sich nicht ausschließlich auf den Kopf des Clowns, er trug ein ausgebeultes gelbes Hemd mit Punkten in orange und am Hals hatte er eine grünblau gepunktete, riesige Fliege. Seine giftgrüne Ballonhose, die mit roten Flicken bedeckt war, wurde von zwei violetten Trägern gehalten und an den Füßen steckten die typischen riesigen, roten Clownschuhe. In den von Handschuhen geschützten Händen hielt er ein kleines, braunes Akkordeon. Ich dankte Gott, dass es ihm nicht einfiel mir auf der Quetschkommode ein Ständchen zu bringen, doch trotzdem drangen die schrecklichen Töne des Akkordeons an mein Ohr bei jeder Bewegung des Clowns.
Wäre ihm doch noch eingefallen mir ein Lied vorzuspielen hätte ich sein so genanntes Instrument auf eine Reise durch seinen Darm geschickt, doch er ging an mir vorbei, das impertinente Grinsen immer noch wie in Stein gehauen auf dem Gesicht.
Er wackelte ins Café hinein und ich hoffte die Kellnerin würde ihn im hohen Bogen wieder rausschmeißen und zu meiner Verwunderung kam er tatsächlich ein paar Sekunden später wie von der Tarantel gestochen aus dem Café gerannt. Sein Akkordeon hatte sich auf einmal in einen Aktenkoffer verwandelt. Er lief über die Straße, die nur selten mal ein Auto von unten sah und auf der gegenüberliegenden Seite verschwand er in einer Gasse, die sich durch ein Gebäude zog. So recht wusste ich nicht, was ich davon halten sollte, also nahm ich erstmal einen großen, beruhigenden Schluck aus der Tasse, doch bevor ich dies tun konnte, flog mir bereits das halbe Café um die Ohren. In einer gewaltigen Explosion flog die große Fensterscheibe des Cafés durch die Luft, in kleinen Splittern, doch ich hatte Glück und bekam keines der Geschosse ab. Die Marquise des Cafés wurde zerrissen und die ganzen Terrassenmöbel des Cafés flogen umher und ich mittendrin.
Ein paar Augenblicke später wachte ich unter einem Sonnenschirm auf, der Schutt hatte sich noch nicht komplett gelegt und ich sah noch wie die restlichen Ballons gen Himmel flogen.
Als ich endlich wieder auf den Füßen stand, konnte ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum ging weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern...
Noch ziemlich benommen und mit einem unerträglichen Piepton im Ohr sah ich mich um.
Die kleine Straße sah immer noch genauso malerisch aus, wie vor der Explosion.
Die rote Litfasssäule, die perfekt in das Bild dieser Straße mit seinen aneinander gereihten Bäumen passte, die alten Wohnhäuser von schönem Bau und vor dem Café, unbeschadet, der dreiköpfige Laternenpfahl, landestypisch aus Eisen gefertigt.
Nur das Café störte den Blick, alles war vom Ruß ganz schwarz.
Die Explosion hat das Glas in tausend Stücke zerlegt und ein riesiges Loch hinterlassen, die Marquise war völlig abgebrannt und die Tische und Stühle, manche kaputt, waren über den Bürgersteig verteilt. Ich beugte mich über den Schirm, der mich vor der Wucht der Bombe geschützt hatte, wenigstens ein wenig. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre – aber nicht sehr viel. Ich richtete mich wieder auf und ging hinüber zu dem Tisch, an dem ich bis vor ein paar Momenten noch gemütlich saß.
Nun lag er ramponiert auf der Seite. Mein erster Impuls war, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann dachte ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren.
Langsam verklang der Piepton in meinen Ohren und der Schwindel ließ nach, sodass ich wieder klar denken konnte. Erst jetzt dachte ich an die arme Kellnerin und den alten Mann.
Sie mussten tot sein. Kurz entschlossen rannte ich über ein paar herumliegende Trümmer ins Café. Es bot sich mir der gleiche Anblick, den ich auch von draußen hatte, leider.
Die ehemals liebevolle Einrichtung war nun völlig hinüber. Der Putz fiel von den Wänden und gab die Sicht auf Ziegelwände frei. Die an der Wand hängenden Spiegel waren wie die Fensterscheibe zerbrochen, die Bar war in sich zusammengefallen, doch die roten Hocker davor standen noch wie eh und je. Die Mitte des Raumes war völlig frei geräumt.
Alle Tische und Stühle waren an den Seiten verteilt. Zu meiner Rechten lag der alte Herr von vorher, begraben unter kaputten Rundtischen. Mir war sofort klar, dass dieser Mann tot war.
Ich bin zwar kein Mediziner, aber auch ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Mensch so verbogen ist und seine gesamte untere Hälfte fehlt, er dem Tod wesentlich näher als dem Leben sein muss. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen hatte. Ich beugte mich zu ihm runter und versuchte, seinem Blick auszuweichen, während ich seine Taschen durchsuchte. Ich merkte wie der Schweiß sich auf meiner Stirn bildete. Ich benutzte den Ärmel meiner dunkelgrünen Jacke um ihn wegzuwischen.
Ich fand nichts. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es war, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hatte. Für die Polizei würde es aber wahrscheinlich kein Problem werden, den Mann trotzdem zu identifizieren, denn die Leiche hatte nur leichte Brandwunden.
Ich ließ von dem Toten ab und kniff die Augen zu, während ich meinen Blick durch den Raum wandern ließ um irgendwo den Rockzipfel der Kellnerin zu sehen, wie er aus einem Haufen von Trümmern hing. Beim Umherschauen fiel mir eine Flasche ins Auge, die auf dem Tresen der Bar stand und wie durch ein Wunder dem Inferno entgangen ist.
Ich fühlte das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen.
Ich verlor sofort das Interesse an der Flasche als ich ein Rascheln hörte.
Hinter mir, unter eine Bank gerutscht, lag die bewusstlose Barkeeperin.
Ich griff ihr buchstäblich unter die Arme und half ihr hoch. Sie kam gerade wieder zu sich, als ich sie an die Lehne der Bank anlehnte. Sie sah kurz verwirrt zu mir auf und hielt ihren Kopf mit den Händen fest, als ob er gleich hinweg springen würde.
„Oh, mein Kopf. Nie wieder! jammerte sie.
Nicht nur ich hatte riesige Kopfschmerzen von der Explosion, aber wie ich schien auch die Kellnerin körperlich unbeschadet geblieben zu sein.
Sie sah mich wieder an, während sie ihren Kopf auf eine Hand stützte.
„Wie viel Wodka hab’ ich getrunken? Nein, sag’ es mir lieber nicht! Wie heißt du, Cheri?“ fragte sie mich. Ich dachte, sie wollte mich für Dumm verkaufen, aber man konnte ihre Verwirrtheit nachvollziehen, das war ja auch ein ziemlicher Knall gewesen.
Ich teilte ihr meinen Namen mit, wobei ich darauf achtete, nicht zu laut zu sprechen: „George Stobbart, Ma’am.“
Sie klang etwas überrascht und fragte, ob ich Amerikaner sei.
Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen.
Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben.
Halb als Scherz, halb ernst gemeint, meinte ich: „Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen...“
Sie hängte ihren Satz ohne Pause an meinen an: „Ich könnte einen Drink gebrauchen!“
Ich hatte dieses zierliche, französische Mädchen wohl ein wenig falsch eingeschätzt.
Anscheinend war das zierliche, französische Mädchen eine handfeste Trinkerin.
„Mir ist schlecht, schwindlig, ich fühle mich mies – und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war!“
Ich versuchte sie wieder ein wenig zu beruhigen und hoffte, sie würde bald merken, was eigentlich geschehen war: „Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt.“
„Wie bitte? Was ist passiert?“ fragte sie, wieder die Unschuld in Person.
„Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen.“ riet ich ihr.
Daraufhin fragte sie mich ob ich Arzt sei.
„Nö, aber als Kind hab’ ich immer Krankenhaus gespielt.“ antwortete ich mit einem Grinsen im Gesicht. Das Grinsen verschwand wieder aus meinem Gesicht und ich kam wieder zum Ernst der Lage zurück: „Können Sie sich denn an gar nichts erinnern?“
Und auf einmal verwandelte sich die kleine Französin wieder in die Trinkerin: „Non. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy.“
Ich habe ihr klar gemacht, dass sie einen Schock erlitten hatte, also keinen Alkohol trinken sollte. Ich hatte das Gefühl, dass ihr Kopf so langsam wieder klarer wurde.
„Was ist mit dem alten Mann – ist er tot?“ fragte sie mit einer zitterigen Stimme.
„Natürlich nicht.“
Ich wollte kein hysterisches französisches Mädchen am Hals haben – wenigstens in dem Augenblick nicht. Um sie etwas bei Laune zu halten bis die Polizei eintraf, fragte ich sie aus.
Zuerst fragte ich, ob sie den alten Mann kannte. Sie sagte, dass sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Als nächstes interessierte ich mich dafür, wie sich der alte Mann benahm und sie meinte, er wäre nervös gewesen, schaute sich ständig um – zur Tür, auf die Uhr.
„Als ob er auf jemanden warten würde?“
„Ja, würde ich sagen. Er hatte vor irgendetwas Angst, das ist sicher.“
Sie begann etwas zu flüstern, als ob der Mann sie noch immer hören konnte, na ja, ich hatte sie ja auch in dem Glauben gelassen, er würde noch leben.
„Wenn Sie mich fragen, hatte er eine Affäre. Er hatte diesen schuldbewussten Blick... wie ein Ehemann auf Abwegen.“
Man soll ja eigentlich nicht schlecht über Tote reden...
„Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam?“
„Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Es war die reinste Begräbnismusik.“ sagte sie mit verzogenem Mund.
Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden.
Ich erkundigte mich, ob der Clown mit dem alten Mann gesprochen hatte.
Das Fräulein entgegnete, dass der Clown den Mann nur ausgelacht habe.
„Dann grabschte er sich den Koffer des alten Mannes und rannte raus.“ fuhr sie fort.
„Hat der alte Mann versucht, den Clown zu stoppen?“
„Oh, dazu hatte er überhaupt keine Möglichkeit. Der Clown ließ sein Akkordeon fallen und rannte zur Tür hinaus. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht mehr.“ Ihre Stimme klang immer wehleidiger und ich stellte im Gedanken die Vermutung an, dass das Akkordeon mit einer Bombe versehen war, raffiniert, eigentlich zu raffiniert für einen Clown.
„Haben Sie gesehen, was der alte Mann in seinem Koffer hatte?“ Das interessierte mich brennend. Es musste irgendetwas überaus Wertvolles gewesen sein.
Die Bedienung ließ meine Träume sofort wieder verpuffen. Der Mann hatte den Koffer nicht geöffnet. Ich wollte wissen, was der alte Mann tat, als der Clown sich den Koffer grabschte.
„Nichts. Er saß einfach da, wie erstarrt.“ Sie rief sich wohl das Gesicht des Mannes wieder ins Gesicht, denn sie begann zu weinen und ließ ihren Kopf wieder in ihre Handflächen plumpsen. Sie sollte im Café bleiben, während ich mich draußen nach Beweisen umsehen wollte. Ich kam mir langsam vor wie Sherlock Holmes oder mit ein paar Jahren mehr Columbo. Ich mochte Detektivgeschichten schon immer und langsam, aber sicher packte mich der Ehrgeiz, den Clown hinter Gittern zu sehen und zwar ungeschminkt.
Ich legte meine Hände an meine Hüfte und begann tief ein und auszuatmen, um meinen Denkfluss ein wenig zu erhöhen. Auf dem Bürgersteig war nichts von Interesse.
Ich beschloss, bis die Polizei eintraf, auf eigene Faust den Fluchtweg des Mörders zu verfolgen und als ich gerade einen Schritt auf die Straße getan hatte, fiel mir eine Zeitung auf, die sich um den Laternenpfahl gewickelt hatte. Ich hob die Pariser Tageszeitung auf und schlug zufällig den Leitartikel auf. Er erzählte etwas über den Besuch eines Nobel – Preis – Gewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das war aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest bestand aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Ganz klar eine Zeitung von der Sorte, die ihren Inhalt mit Sex, Skandalen und Sportergebnissen bestreitet. Ich überflog die Seite.
Mir fiel die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Dort stand: ‚Salah – eh Dinn, 13 45’.
Nun, so wirklich etwas anfangen konnte ich damit nicht, also steckte ich mir die Zeitung ein und begab mich in die Gasse, in die ich den Clown hatte flüchten sehen.
Im Großen und Ganzen war die Sackgasse ziemlich verdreckt, die Wände waren fast nackt, überall lag Müll herum, hauptsächlich alte Glasflaschen und marode Kartons.
Zu meiner Rechten befand sich ein Regenrohr an der Hauswand, es sah so aus, als ob es mein Gewicht tragen konnte. Ich holte tief Atem und begann, das Regenrohr hochzuklettern.
Leider klappte dieses Vorhaben nicht denn das Rohr brach ab, als ich nur einmal leicht daran zog. Ich nahm an, dass der Clown über die Dächer getürmt war.
Neben dem Regenrohr war ein Fenster in der Hauswand, geschützt durch solide wirkende Eisenstäbe. Ich rüttelte an den Stäben, um zu sehen, ob der Clown vielleicht durch das Haus geflüchtet war, doch die Stäbe bewegten sich im Gegensatz zu dem Rohr keinen Millimeter.
Diese Möglichkeit konnte ich also wieder ausschließen. Weiter an der Wand entlang standen drei Mülltonnen und dazwischen ein Stapel Kartons, in denen mal Weinflaschen verpackt waren. Die Untersuchung der ersten Mülltonne erbrachte nichts, sie war schlicht und ergreifend leer. Ich untersuchte die Kartons genauer. Sie waren feucht, ziemlich muffig und einwandfrei leer. Nun fokussierte ich mich auf die zweite Tonne.
Als ich sie öffnete stieg mir der Gestank entgegen. Es roch, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte.
Ich knallte den Deckel wieder auf die Tonne, ich wollte mir nicht einmal die ausmalen, was die Quelle des Gestanks war. In der dritten Tonne stank es zwar nicht so höllisch, aber trotzdem habe ich mich höllisch erschrocken, da eine schwarze Katze dort ihr Schläfchen hielt und als ich den Deckel anhob, sprang mir die Straßenkatze entgegen und lief davon.
Ich beschloss nicht weiter im Müll zu graben, aber um mein Missfallen kundzutun, trat ich gegen eine herumliegende, sowieso schon verbeulte Plastikkiste.
Als ich mich gerade wieder umdrehte, um zum Café zurückzukehren, fiel mir eine Eisenplatte im Boden auf, die den Eingang zu einem Kanalisations- oder Abflussrohr versperrte.
Das war noch eine Möglichkeit, der Clown hätte eventuell durch die Kanalisation flüchten können, mit dem richtigen Werkzeug, denn mit den bloßen Händen bekam ich den Gullydeckel nicht auf, da ich keinen guten Angriffspunkt fand.
Enttäuscht begab ich mich auf die Straße zurück, auf der mir vorher eine kleine Baustelle aufgefallen war, in der ein klobiger Mann den Boden mit einer Spitzhacke bearbeitete.
Er musste auch etwas gesehen haben, denn die Baustelle war nicht sehr weit vom Café entfernt. Im Laufschritt ging es hinüber zur Baustelle, die im Eingang in die angrenzende Allee lag. Ich war gerade in die Schatten der Bäume an der Seite der Allee getreten, da kam mir endlich die Polizei entgegen, genauer gesagt war es ein einzelner Gendarm.
Ich wollte ihn gerade begrüßen und auf den Tatort verweisen, als er plötzlich seine Waffe zückte, in die Knie ging und auf mich zielte. Der Gendarm war schon ein wenig älter, graues Haar, dicker Schnauzer, der seinen Mund fast komplett verdeckte.
Er trug die für Frankreich typische Gendarmenuniform in schwarz mit einer schwarzen Kappe auf dem grauen Haupt. Seine Hände waren von weißen Handschuhen umgeben und er hatte goldenes Zeug auf den Schultern, das aussah wie zwei Besen – Enden.
„Stopp! Keine Bewegung!“ rief er mir zu.
Der Bauarbeiter stellte seine Arbeit erst einmal ein, um sich als Schaulustiger zu betätigen.
Ich hob meine Hände und rief: „He – nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner!“
„Können Sie sich nicht für eins entscheiden?“ fragte er in lautem Ton.
Ich verlangte schon mal vorsorglich, mit dem amerikanischen Konsul zu sprechen.
Er ignorierte mein Verlangen und befahl mir, meine Waffen fallen zu lassen und mich auf den Boden zu legen. Nur gut, dass ich Pazifist bin. Hinter dem schießwütigen Polizisten kam ein weiterer Mann hinzu, groß, Glatze, ein Bart, der sich um seinen Mund schloss und dicken Augenbrauen. Er trug einen braunen Mantel, wahrscheinlich aus Leder, darunter ein mit Krawatte versehenes Hemd und eine braune Hose.
An den Füßen trug er zwei bestimmt sehr teure Markenschuhe.
„Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Moué.“ wies er seinem Polizistenkollegen in gebieterischem Ton an.
„Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen.“
Seine Stimme klang nun etwas höflicher und man konnte die hohe Intelligenz des Mannes förmlich heraushören. Ich fragte, noch ziemlich verunsichert und zögerlich, ob ich verhaftet sei. Der große Glatzkopf, wolle mir nur ein paar Fragen stellen, versicherte er mir.
Er befahl mich und den Gendarmen zum Café mit einem: „Marchez!“
Die Kellnerin saß immer noch, am Boden zerstört, auf der Sitzbank in der Ecke und rührte sich nicht, auch als wir hereinkamen. Der Sergeant wand sich als erstes der Leiche zu und der Mann im Mantel blieb bei mir.
„Was für ein Anblick! Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr?“
Ich hatte daran gezweifelt, ob dieser Mann so etwas wie Gefühle hatte, aber zu meiner eigenen Beruhigung bestätigte sich mein Zweifel nicht.
„Hören Sie damit auf, Monsieur!“ Die Stimme des Sergeants.
Der Mann, ich schätze mal er war Inspektor oder Kommissar oder so etwas, und ich drehten uns zu Moué um, der über den Toten gebeugt war.
Und wieder befahl Moué dem Toten: „Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten.“
Der andere Polizist, dessen Namen ich immer noch nicht erfahren hatte, teilte anscheinend meine Verwunderung über die Blindheit des Sergeants: „Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Moué?“
„Oui, Monsieur, aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite?“
Wie hatte dieser Kerl nur die Polizeiausbildung geschafft.
Moué sagte weiter: „Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich tot stellte. Na egal, in diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot.“
Anscheinend kam der Sergeant so langsam wieder auf den Boden der Tatsachen.
Sergeant Moué behauptete, dass es sonnenklar war, dass der Killer von der Anwesenheit des Opfers wusste, doch der andere Polizist warnte ihn davor, voreilige Thesen aufzustellen.
Alles, was sie sicher wüssten war, dass der Mann tot war. Da hatte er nicht so ganz Unrecht.
„Ich fand es war logisch, anzunehmen, dass...“ begann Moué und der Glatzkopf unterbrach ihn: „Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel...“
Ich hatte nicht den geringsten Schimmer, wer das war, aber Moué verriet es: „A... aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder Der Alte.“
„Das ist was anderes, Moué – die brauchten ja auch Assistenten.“ Ich hatte den glatzköpfigen Mann wohl doch für etwas intelligenter gehalten, als er tatsächlich war.
„Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen.“ ordnete der Polizist seinem Kollegen an, der sich umgehend daran machte, den Befehl zu befolgen.
„Et maintenant, zum Geschäft.“ Der Mann konzentrierte sich wieder auf mich.
Er kramte in einer Innentasche seines Mantels, aus der er Stift und Notizblock hervorholte.
Er fragte nach meinem Namen, den ich ihm sagte, mit der Bemerkung, dass ich aus Kalifornien komme, falls er danach auch noch fragen wollte.
Der Polizist wollte wissen, was mich nach Paris führte. Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass ich durch Europa reise und er beglückwünschte meine Wahl, da die Stadt zu der Jahreszeit am schönsten war.
„Äh... ja, könnte sein – von den Bomben einmal abgesehen.“ bemerkte ich schnippisch, was mein gutes Recht war, meiner Meinung nach.
„Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging?“
Ich bejahte und sagte, dass ich draußen auf dem Bürgersteig saß.
„Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat!“
Der wohlmögliche Inspektor ignorierte meine Bemerkung komplett und fragte, ob ich gesehen habe, wie der Verstorbene das Café betrat.
„Ja, hab’ ich gesehen.“
„War er allein?“
Ich antwortete knapp mit Ja.
Er erkundigte sich, ob der Mann mit mir sprach und ich sagte: „Nein. Die Kellnerin interessierte ihn viel mehr.“ Was gar nicht so weit hergeholt war, so wie er das Mädchen angesehen hatte.
Mein Gegenüber notierte weiterhin alles auf seinem Block und wollte wissen, ob ich jemand anders in das Café habe gehen sehen. Ich erzählte ihm von dem Typen, der wie ein Clown gekleidet war und ein Akkordeon trug.
„Ein Akkordeon? Bon. Das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch.“
Er steckte seine Schreibsachen wieder zurück und fragte Sergeant Moué, ob das Mädchen in Ordnung sei. Die beiden zogen sich zu einer kurzen Lagebesprechung zurück.
„Sie wird’s überleben. Sie bestätigt die Aussage des Amerikaners. Ein Clown mit einem Akkordeon, zweifellos eine raffinierte und exzentrische Verkleidung.“ flüsterte Moué seinem Vorgesetzten zu.
„Sehr gut.“ sagte er zu Moué und wand sich wieder mir zu: „Eh bien. Ich habe genug gehört.“
Ich wollte wissen, was er damit meinte und er sagte mir, dass er überzeugt war, dass ich nichts wusste und ich gehen könnte.
„Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs.“
Damit wollte ich mich nicht zufrieden geben: „Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben?“
„Was soll ich sagen? Passen sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren...“
Moué hatte auch noch einen Ratschlag für mich: „Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen.“
Ich bedankte mich freundlich für diesen famosen Ratschlag: „Toller Tip.“
Der Polizist war davon überzeugt, dass ich mich nicht im Geringsten in Gefahr befand.
Falls mir noch etwas Wichtiges einfiel, sollte ich ihn anrufen. Er gab mir seine Visitenkarte.
Ich sah sie mir kurz an, darauf stand: ‚Augustin Rosso, Inspecteur de police’.
Er wohnte südlich des Friedhofs von Montparnasse.
Ich ließ die Karte in einer Innentasche meiner Jacke verschwinden und bedankte mich.
„Das wäre alles. Sie können gehen.“ Damit schickte er mich gen Ausgang, doch in der Tür hielt ich einen Moment inne, um dem Gespräch der beiden Polizisten zu lauschen.
„Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur.“
„Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte.“ Der Inspektor hatte anscheinend ein Fable für das Übersinnliche.
„Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch.“ so Moué.
„Akademisch?“ fragte Rosso. „Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden!“ Inspektor Rosso legte seine Hand in Denkerposition an seinen Kopf und beendete damit die Konversation. Als ich wieder auf dem Bürgersteig war, fiel mir eine Frau ins Auge, die den Tatort fotografierte. Sie hatte schwarzes Haar, eine feminine Lederjacke und darunter ein violettes Minikleid an. Dort wo das Kleid aufhörte, begann die schwarze Strumpfhose für das Auge sichtbar zu sein. Die Strumpfhose mündete in blaue Pumps. Ein extravaganter Aufzug, dennoch sehr anziehend. Ihre Kamera hing der jungen Frau um den Hals und weil ich nun mal keine Gelegenheit auslasse, sprach ich sie an: „Verzeihung, Mademoiselle!“ Sie drehte sich zu mir um und ich trat näher an sie heran.
Ich stellte mich vor und sie vermutete aufgrund meiner Sprechweise, dass ich Amerikaner war. Ich bestätigte ihre Vermutung und erwähnte, dass ich auf Urlaub in Paris sei.
„Schöner Urlaub, was?“
Sie fragte: „Du warst hier, als die Bombe hochging?“ Auf einmal hörte sie sich sehr interessiert an.
„So ist es! Ich habe genau vor dem Café gesessen.“
„Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel?“
Ich konnte es nicht glauben, sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühlte, aber ich ließ es ihr einfach durchgehen und berichtete: „Ja. Kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht... mit ihm verwandt?“
„Oh, nein – nichts dergleichen.“ Das beruhigte mich sehr denn ich hatte keine Lust einer schönen Französin zu erklären, dass einer ihrer Angehörigen tot war.
Sie stellte sich vor: „Ich bin Nicole Collard, von ‚La Liberté’.“
„Was ist das – ein Nachtclub?“ fragte ich unbeholfen.
Ich trat mal wieder ins Fettnäpfchen: „Ah, nein – es ist eine Tageszeitung.“
„Du bist Reporterin?“ fragte ich interessiert.
Sie sagte mir, dass sie freie Fotojournalistin sei und ich schlug ihr daraufhin vor, mich über den Bombenanschlag zu interviewen.
„Ein Augenzeugenbericht... Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du – Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme – so was in der Art.“
Ich sah mich schon auf dem Titelblatt aller Zeitungen, derjenige der das Inferno überlebte...
„Ich bleibe bei den Tatsachen, danke.“ Damit zerstörte sie meinen schönen Traum.
„Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat?“
Auf die Gefahr hin, dass sie mich für dumm verkaufen würde, erzählte ich ihr von dem als Clown verkleideten Typen.
Sie war geschockt und in ihrer Stimme und ihrem Gesicht spiegelte sich blankes Entsetzen wider: „Oh Gott! Er hat wieder zugeschlagen...“
Auch ich kam in helle Aufregung, jedenfalls innerlich. Ich fragte Nicole, ob sie den Clown jemals zuvor gesehen hatte.
„Das ist...“ sie zögerte und sprach dann weiter: „... eine lange Geschichte.“
„Ich habe viel Zeit.“
„Ich nicht.“ Ich beließ es vorerst dabei, vorerst, und fragte sie über den Mann aus: „Wer war der Typ, den du treffen wolltest?“
„Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten.“ Sie seufzte, wie ein kleines Mädchen, dass nicht das bekommt, was es will und fuhr fort: „Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte.“
„Es sei denn, du hättest Rossos Gabe der parapsychologischen Befragung.“ Der Witz landete nicht und ich hakte weiter nach: „Woher hat Plantard deinen Namen?“
„Über die Zeitung – ‚La Liberté’. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe, einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich: Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen.“
Beinah hätte ich vergessen zuzuhören, denn ich achtete die ganze Zeit auf ihren schönen, vollen Mund, der sich so geschmeidig bewegte, wenn sie sprach, aber ich bekam Gott sei dank noch die Kurve. Ich kam wieder auf den Clown zurück: „Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen?“
„Warum möchtest du dich da einmischen?“
Was für eine dumme Frage: „Weil er mich fast getötet hätte! Ist das nicht Grund genug?“
Sie kam zur Einsicht: „Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal...“
Sie kramte in ihrer Jackentasche und holte einen zusammengeknüllten Briefumschlag und einen Stift heraus.
„Ich gebe dir meine Telefonnummer.“
Sie gab mir den Umschlag mit der Nummer und sagte: „Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vorneherein klar ist: Das ist rein geschäftlich.“
Das musste ja kommen, aber: „Okay. Abgemacht.“
Damit verabschiedete sie sich: „Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. À bientôt, Monsieur.“
„Gut. Ich, uh... bis bald.“ Trotz allem was bisher passiert war, hatte ich doch wenigstens die Telefonnummer einer echt heißen Französin, die zwar selbstsicher tut, aber hinter dieser Maske eher bockig wirkt, ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Aber haben wir nicht alle unserer kleinen Macken?
Da zog sie von dannen. Ich sah ihr noch einen Moment hinterher und ging dann zu Sergeant Moué rüber, der den Eingang des Cafés bewachte, indem er sich mitten hinein stellte.
Der Sergeant war ein mickriger Mann, der auf gewisse Art einem kopflosen Huhn glich.
„Entschuldigen Sie, Sergeant.“
Er wollte mich sofort wieder abwimmeln: „Sie haben den Inspektor gehört. Gehen Sie nach Haus, Monsieur.“
So schnell ließ ich mich aber nicht vertreiben: „Haben Sie nicht vor, nach dem Mörder zu fahnden, Sergeant?“
„Nein, mein Herr. Der Inspecteur hat mir ausdrückliche Anweisung gegeben, diese Türe zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck.“ entgegnete er mir mit seinem überaus starken Akzent.
„Ich habe gesehen, wie der Clown in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt ist.“
Moué fragte mich, ob ich dem Clown gefolgt bin und ich sagte, dass keine Spur mehr von ihm zu sehen war, als ich in die Gasse ging. Ich erklärte ihm auch meine beiden Vermutungen über den Fluchtweg des Clowns, die Dächer und die Kanalisation, obwohl es mir viel wahrscheinlicher erschien, dass der Mörder durch die Kanalisation geflüchtet war.
„Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt?“ fragte er mich, obwohl er die Antwort sicher wusste.
„Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben.“ scherzte ich. Sergeant Moué versuchte immer noch mich zu abzuwimmeln, indem er mir versicherte, dass Inspektor Rosso eine vernünftige Suche organisieren würde.
„Wie konnten Sie und Rosso so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion! Hatten Sie einen Tipp bekommen?“ wollte ich wissen.
„Diese Informationsquellen von Inspecteur Rosso sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur.“
Während der Sergeant mit mir redete, schaute er immer wieder ins Café, wahrscheinlich wollte er nicht, dass Rosso ihn mit mir reden sieht. Dann, als er sich sicher war, dass Rosso beschäftigt war, schwenkte er seinen Kopf näher zu mir und flüsterte: „Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen.“
Ich fragte ihn, was er glaubte und er flüsterte noch leiser, fast in einem Hauchen: „Ich glaube, er ist selbst der Teufel.“
„Was macht Rosso mit dem Mädchen?“ fragte ich, als ich einen Blick an Moués Schulter vorbei warf und sah, wie Rosso auch mit der Kellnerin sprach.
„Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet.“
„Bitte?“
„Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab.“ verriet mir Sergeant Moué.
Ich fragte ihn über die Sache mit dem Übersinnlichen: „War das sein Ernst mit dem ganzen Psycho – Polizisten – Kram?“
„Natürlich! Inspecteur Rosso ist ein Pionier und Visionär! Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln!“ Ich hatte so leicht das Gefühl, dass man die Beziehung der beiden Polizisten zueinander mit dem Guru und seinem Anhänger vergleichen konnte.
„Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass so was in L. A. klappt.“ dachte ich laut.
Um das Gespräch auf Plantard, den Toten, zu lenken, erzählte ich dem Sergeant von den Gedanken, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf gingen: „Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant.“
„Haben Sie damit irgendein Problem?“
Damit bewies Sergeant Moué erneut, dass es ihm ausnahmslos an Feingefühl fehlte, aber wenigstens war das Gespräch nun auf den Toten gerichtet.
„Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen.“
Ich bekam die Antwort, die ich in diesem Augenblick von jedem Polizisten erwartete: „Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur.“
Moué fragte jedoch auch noch, ob das Opfer mit mir gesprochen hatte.
Plantard hatte mir nur zugenickt, mehr nicht.
„Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit.“
Wie konnte ich das vergessen, schließlich wäre ich um ein Haar selber hopsgegangen.
Nach kurzem Überlegen, teilte ich Sergeant Moué den Namen des Opfers mit und er fragte hellhörig, ob ich das Opfer also doch kannte.
„Nein, aber...“
Moué unterbrach mich zu meiner Verwunderung: „Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt.“
„Ich versuche nur, Ihnen zu helfen!“ beteuerte ich.
„Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur.“
Ich konnte es nicht glauben, Sergeant Moué war es wichtiger, seine Ruhe vor mir zu haben, als etwas über den Fall in Erfahrung zu bringen. Ich ließ mich jedoch noch nicht völlig entmutigen und zeigte ihm die Zeitung, die ich gefunden hatte.
„Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf – ‚Salah – eh Dinn, 13 45’.“
Meine Anregung mit der Zeitung fruchtete sogar denn ich brachte Moué wenigstens ein wenig ins Grübeln: „Ah! Also war das Treffen mit dem Clown geplant!“
„Wie kommen Sie denn darauf?“ Ich befürchtete, der Sergeant verfehlte die Tatsachen ein wenig bei seinen Vermutungen.
„Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen halb Zwei und Zwei, n’est – ce pas?“
„Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen?“
Es schien zuerst, als ob der Gendarm einen Geistesblitz hätte, doch anscheinend war es nur ein Funke.
„Das wirft Sie aus dem Sattel, was?“
„Ich bin noch niemals in meinem Leben – wie Sie es auszudrücken belieben – aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur.“ Er war wohl ein wenig beleidigt, obwohl meine Frage nicht beleidigend sein sollte.
Moué sprach seine Vermutung aus: „Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, non?“
„Salah – eh Dinn, der Clown? Das glaube ich weniger.“
Ich konnte erkennen, dass es dem Sergeant nicht gefiel, wie ich seine Mutmaßungen entkräftete, also verabschiedete ich mich, bevor ich noch wegen einem unersichtlichen Grund verhaftet werden würde. Mein nächstes Vorhaben bestand darin, den Bauarbeiter an der Straßenecke zu befragen und von irgendwo her ein Werkzeug zu bekommen mit dem ich den Kanalisationsdeckel aufhebeln konnte. Die kleine Baustelle oder besser gesagt Baugrube lag direkt auf dem Bürgersteig an einer Hauswand mit einem großen Holztor.
Der muskulöse Straßenarbeiter, schon ein älterer Kerl und wahrscheinlich ein paar Jahre vor dem Ruhestand, trug eine Miene zur Schau, die auf fünf Meter Entfernung deutlich besagte: Lass mich in Ruhe, ich habe zu tun! Natürlich war mir das völlig egal.
Neben der kleinen Grube, in der der Mann mit einer Spitzhacke herumhantierte, stand ein aus Plastikplanen bestehendes Zelt, in dem nur ein großer zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall stand. Neben dem Zelt lag ein großes Bauarbeiter – Telefon, das verdammt schwer aussah.
„Hi! Hätten Sie mal eine Sekunde Zeit?“ fragte ich den Arbeiter und hoffte nicht seine Hacke abzubekommen. Er hörte auf, den Boden zu malträtieren und sah mich aus seinen tiefen Augenhöhlen grimmig an: „Ich dachte, Sie wären im Knast...“
Ich teilte ihm mit, dass das nur ein Missverständnis war.
„Als der die Knarre rausholte – boah – ich dachte, das war’s.“
Der Typ war keinesfalls so, wie man sich einen Franzosen vorstellte, aber das Klischee vom feinfühligen Charmeur war sowieso veraltet.
„So ne Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie.“ berichtete er mir.
„Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist.“
„Sie? Ein Terrorist? Ha!“ So unschuldig sehe ich doch nun wirklich nicht aus.
Gut, ich bin kein Dirty Harry, aber eine gewisse Verwegenheit kann mir doch wohl nicht absprechen.
„Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt.“ sagte ich und versuchte, mich nicht beleidigt zu fühlen.
Ich begann meine Befragung damit, zu fragen, ob er einen älteren Herrn mit Koffer gesehen hatte.
„Oui. So ‘n alter Blödmann! Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können!“ Er streichelte den Stiel seiner Hacke mit seinen dreckigen Handschuhen.
Sein ehemals weißes Hemd hatte er an den Armen hochgekrempelt. Der Bauarbeiter war zwar ein wenig dick, trotzdem sehr muskulös, was wohl einerseits vom reichhaltigen französischen Essen und andererseits von der Bauarbeit herrührte.
„Haben Sie den alten Mann erkannt?“ wollte ich wissen und er sagte Nein.
Er fragte, ob er den Mann erkennen sollte und ob er berühmt war.
„Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard.“
„Was soll das heißen? Ist er tot?“
Erfasst und auf einmal wandelte sich seine Rauheit in Mitgefühl um, was mich sehr verwunderte, positiv.
„Jetzt tut’s mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe.“ Er übertrieb es jedoch ein wenig.
„Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen! Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen!“
Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern.
Zu schlechten meistens. Ich lenkte das Gespräch auf den Mörder und fragte den Mann, ob ein Clown an seinem Arbeitsplatz vorbeigekommen wäre.
„Ein Clown? Wie im Zirkus?“
„Ja. Voll geschminkt und mit einer großen roten Nase.“
„Ho! Die Typen sind witzig, ey?“
„Hab ich andere Erfahrungen gemacht.“
„Ich mag den Zirkus – besonders die Pferde.“
Er hatte meine Frage noch nicht beantwortet, also fragte ich nochmals, ob er einen Clown gesehen hatte.
„Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen.“
Und das sagte er ausgerechnet mir, schließlich bin ich Anwalt.
„Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen.“
„Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen – ich hab nix und niemanden gesehen.
Ich wagte noch einen Versuch: „Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make – Up!“
„Wär ‘n komischer Clown, wenn’s anders wär’...“
Langsam ging meine Geduld wirklich zu Ende: „Hören Sie – ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer.“
„Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Bulle?“ fragte er so abwertend, dass es nur Absicht sein konnte.
„Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus?“
„Vermutlich nicht. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen?“ Langsam aber sicher zweifelte ich an dem menschlichen Verstand einiger Leute in Paris.
„Was, haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen.“ berichtete ich dem Unwissenden.
„Der Clown hat den alten Mann umgebracht?“
„Genau. Hat ihn mit einer Bombe weggepustet, die in seiner Quetschkommode versteckt war.“
„Merde! Aber warum hat er sich als Clown verkleidet?“
„Wer weiß schon, was im Kopf von so einem Killer vor sich geht? Ich nehme an, der hat irgendein tief sitzendes psychologisches Problem – oder er will einfach nur auffallen.“ vermutete ich.
Die Sache hatte keinen Sinn, der Kerl hatte nichts gesehen, aber ich kam auf die glorreiche Idee in seiner Werkzeugkiste nach einem geeigneten Kanaldeckel – Aufmach – Dingens zu suchen, doch der rabiate Bursche vereitelte meinen Plan: „He, nix da! Hauen Sie schon ab!
Was denken Sie sich eigentlich?“ schnauzte er mich an.
„Ich habe... Ihren Werkzeugkasten bewundert.“ log ich ihm frech ins Gesicht.
„Ah, oui? Genug gesehen jetzt? Ich warne Sie – wenn Sie die Kiste anfassen, ramme ich Ihnen die Zähne ins Gehirn.“
„Okay! Ich hab schon kapiert.“ Das stimmte zwar, aber Aufgeben wollte ich noch nicht.
„Hey!“ rief ich so nett man Hey rufen konnte.
„Was wollen Sie denn diesmal?“ fragte er, sichtlich genervt.
Ich bot ihm meine Zeitung an, doch er sträubte sich: „Zum Lesen hab’ ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin?“
Ich schlug ihm vor: „Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen.“
„Ich hab’ gerade mal zehn Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das.
Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste.“
Jetzt reichte es mir allmählich, ich startete den Frontalangriff: „Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei.“
Es klappte. Grummelnd griff er sich die Zeitung und überflog kommentierend die Artikel: „Pah! Es ist unglaublich! Diese verdammten weichherzigen Liberalen! Pfft! Die Delphine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung! So ein Theater wegen ein paar Fischen!“
Jetzt wusste ich auch, warum dieser Kerl Bauarbeiter und nicht etwa Biologe geworden war.
„Oha, das ist schon besser! Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß! Wie Sektkorken, non?“ Ich hoffte, er sprach von dem Seite – Drei – Mädchen.
„Ah. Was ist denn das? Salah – eh Dinn – läuft beim Großen Preis vom Arc de Triomphe!“
„Ist das ein Rennpferd?“ fragte ich unwissend.
„Ein Pferd?“ Er hörte sich nun an wie ein brasilianischer Fußballkommentator: „Eine Legende, mon ami! Schnell wie der Blitz ist sie!“
Er kroch aus seiner Grube und ich war mir nicht sicher, was er nun anstellen wollte.
„Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen!“
Geschafft! Mein Plan war tatsächlich aufgegangen.
„Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten?“
„Vergiss es, Kumpel! Bedien dich!“ Und damit marschierte er davon, bereit all sein Geld zu verzocken, aber ich hatte mein Ziel erreicht und hoffte, dass der Werkzeugkasten auch das richtige Werkzeug enthielt denn sonst wäre alles umsonst gewesen, die ganze angewandte Überredungskunst. Ich schmiss mich auf die Kiste wie ein hungriger Wolf auf seine hilflose Beute und tatsächlich, ich fand genau das, was ich brauchte – ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln konnte. Es war ein Metallstab mit einem Griff am einen und einer kurzen Querstrebe am anderen Ende.
Paris im Herbst.
Die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends.
Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden.
Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe... und an Tod.
Ich saß in einem kleinen Café, mitten in Paris und genoss den Ausblick auf den Eiffelturm.
Die Bäume entließen ihre rotgoldenen Blätter in den Herbsthimmel, ein echtes Postkartenbild.
Ein anderes Postkartenbild war die Kellnerin des Cafés, eine junge, blondhaarige Französin, die mir eine Tasse Kaffee brachte, die endlich einmal eine ordentliche Größe hatte.
In den meisten Cafés in Paris bekommt man nur einen Fingerhut mit zwei Tröpfchen Kaffee darin. Das junge Fräulein stellte den Kaffee samt Untertasse auf den runden Tisch, aus dessen Mitte ein Sonnenschirm in denselben Farben der Marquise des Cafés ragte, blau und gelb.
Die Bedienung hatte einen roten Mini an, um die Hüften eine Schürze geschwungen, die ihre natürliche Weiße behalten hatte. Das strohblonde Haar der Französin wurde von einem Haarreifen gebändigt, der dieselbe Farbe wie ihr Kleid und ihre Stöckelschuhe hatte.
Ich strich mir durch mein engelsblondes Haar und lächelte ihr auf meine charmante kalifornische Art zu und sie erwiderte das Lächeln ohne ein Wort zu sagen, ich wusste nicht wie gut ihr Englisch war, ich wusste nur das es um mein Französisch schlecht aussah, doch das war in diesem Frankreichurlaub bisher noch kein Problem gewesen, da eigentlich jeder ein wenig Englisch konnte. Die großen, aquamarinfarbenen Augen der Kellnerin strahlten mir entgegen, doch abgelenkt durch mich rannte sie frontal in einen älteren Herrn mit grauem Hut und Trenchcoat, der ins Café wollte. Der Mann, dessen ergraute Haare unter dem Hut vorlugten, hatte eine Brille auf und trug einen braunen Aktenkoffer bei sich.
Das Mädchen erschrak, doch der Mann zupfte an seinem Hut und nickte ihr freundlich zu.
Die Kellnerin schenkte nun dem alten Herrn ein bezauberndes Lächeln.
Ich steckte mir derweil einen Zahnstocher, den ich mir im Hotel in die Tasche gesteckt hatte, in den Mund und kaute darauf. Ich fragte mich, ob das Mädchen immer so schnell war mit dem Verteilen von eindeutigen Blickkontakten. Der Mann schenkte auch mir ein kurzes, nicht ganz so offenes Nicken und die beiden begaben sich in das Café.
Wahrscheinlich nur Touristen wie ich sitzen auf dem Bürgersteig, im Herbst.
Ich überlegte mir, mich auch ins Café zu setzen, als etwas Buntes in mein Blickfeld trat.
Es waren Luftballons, blaue, rote und gelbe, alle mit dem gleichen penetranten, grinsenden Gesicht versehen. Ich reagierte mich ein wenig ab, indem ich einen der Ballons mit meinem Zahnstocher zum platzen brachte, doch das hielt die anderen Ballons leider nicht davon ab, weiter zu grinsen wie eine Horde Honigkuchenpferde.
Als der Ballon in Fetzen zerplatzte, äugte mich dahinter ein genauso impertinentes Grienen an. Ein Clown! Ich hasse Clowns und Pantomimen. Wer mir erzählt, dass die Späße dieser Scharlatane vom Dienst einen humoristischen Wert haben, den würde ich einfach mal als dümmlich bezeichnen.
Dieser Clown, der mir vor dem Café entgegenfeixte war ein komplettes Packet an Clownerie.
Auf dem völlig geschminkten Kopf thronte ein überdimensional kleiner Hut. An den Hinterkopf hatte sich der Spaßvogel die typischen, roten Clownhaare geklebt, die an beiden Seiten seines Schädels hervorsprossen. Seine buschigen Augenbrauen waren gelbblau angemalt und sein Mund mit roter Farbe umrandet, die sein Grinsen noch verzerrter wirken ließ. Das Prunkstück seiner Fratze war das, was keinem Angehörigen dieser Spaßfraktion fehlen durfte, die legendäre rote Nase. Ein runder, knallroter Ball, mitten im Gesicht dieses Amateurschelms. Doch die Farbenprächtigkeit belief sich nicht ausschließlich auf den Kopf des Clowns, er trug ein ausgebeultes gelbes Hemd mit Punkten in orange und am Hals hatte er eine grünblau gepunktete, riesige Fliege. Seine giftgrüne Ballonhose, die mit roten Flicken bedeckt war, wurde von zwei violetten Trägern gehalten und an den Füßen steckten die typischen riesigen, roten Clownschuhe. In den von Handschuhen geschützten Händen hielt er ein kleines, braunes Akkordeon. Ich dankte Gott, dass es ihm nicht einfiel mir auf der Quetschkommode ein Ständchen zu bringen, doch trotzdem drangen die schrecklichen Töne des Akkordeons an mein Ohr bei jeder Bewegung des Clowns.
Wäre ihm doch noch eingefallen mir ein Lied vorzuspielen hätte ich sein so genanntes Instrument auf eine Reise durch seinen Darm geschickt, doch er ging an mir vorbei, das impertinente Grinsen immer noch wie in Stein gehauen auf dem Gesicht.
Er wackelte ins Café hinein und ich hoffte die Kellnerin würde ihn im hohen Bogen wieder rausschmeißen und zu meiner Verwunderung kam er tatsächlich ein paar Sekunden später wie von der Tarantel gestochen aus dem Café gerannt. Sein Akkordeon hatte sich auf einmal in einen Aktenkoffer verwandelt. Er lief über die Straße, die nur selten mal ein Auto von unten sah und auf der gegenüberliegenden Seite verschwand er in einer Gasse, die sich durch ein Gebäude zog. So recht wusste ich nicht, was ich davon halten sollte, also nahm ich erstmal einen großen, beruhigenden Schluck aus der Tasse, doch bevor ich dies tun konnte, flog mir bereits das halbe Café um die Ohren. In einer gewaltigen Explosion flog die große Fensterscheibe des Cafés durch die Luft, in kleinen Splittern, doch ich hatte Glück und bekam keines der Geschosse ab. Die Marquise des Cafés wurde zerrissen und die ganzen Terrassenmöbel des Cafés flogen umher und ich mittendrin.
Ein paar Augenblicke später wachte ich unter einem Sonnenschirm auf, der Schutt hatte sich noch nicht komplett gelegt und ich sah noch wie die restlichen Ballons gen Himmel flogen.
Als ich endlich wieder auf den Füßen stand, konnte ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum ging weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern...
Noch ziemlich benommen und mit einem unerträglichen Piepton im Ohr sah ich mich um.
Die kleine Straße sah immer noch genauso malerisch aus, wie vor der Explosion.
Die rote Litfasssäule, die perfekt in das Bild dieser Straße mit seinen aneinander gereihten Bäumen passte, die alten Wohnhäuser von schönem Bau und vor dem Café, unbeschadet, der dreiköpfige Laternenpfahl, landestypisch aus Eisen gefertigt.
Nur das Café störte den Blick, alles war vom Ruß ganz schwarz.
Die Explosion hat das Glas in tausend Stücke zerlegt und ein riesiges Loch hinterlassen, die Marquise war völlig abgebrannt und die Tische und Stühle, manche kaputt, waren über den Bürgersteig verteilt. Ich beugte mich über den Schirm, der mich vor der Wucht der Bombe geschützt hatte, wenigstens ein wenig. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre – aber nicht sehr viel. Ich richtete mich wieder auf und ging hinüber zu dem Tisch, an dem ich bis vor ein paar Momenten noch gemütlich saß.
Nun lag er ramponiert auf der Seite. Mein erster Impuls war, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann dachte ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren.
Langsam verklang der Piepton in meinen Ohren und der Schwindel ließ nach, sodass ich wieder klar denken konnte. Erst jetzt dachte ich an die arme Kellnerin und den alten Mann.
Sie mussten tot sein. Kurz entschlossen rannte ich über ein paar herumliegende Trümmer ins Café. Es bot sich mir der gleiche Anblick, den ich auch von draußen hatte, leider.
Die ehemals liebevolle Einrichtung war nun völlig hinüber. Der Putz fiel von den Wänden und gab die Sicht auf Ziegelwände frei. Die an der Wand hängenden Spiegel waren wie die Fensterscheibe zerbrochen, die Bar war in sich zusammengefallen, doch die roten Hocker davor standen noch wie eh und je. Die Mitte des Raumes war völlig frei geräumt.
Alle Tische und Stühle waren an den Seiten verteilt. Zu meiner Rechten lag der alte Herr von vorher, begraben unter kaputten Rundtischen. Mir war sofort klar, dass dieser Mann tot war.
Ich bin zwar kein Mediziner, aber auch ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Mensch so verbogen ist und seine gesamte untere Hälfte fehlt, er dem Tod wesentlich näher als dem Leben sein muss. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen hatte. Ich beugte mich zu ihm runter und versuchte, seinem Blick auszuweichen, während ich seine Taschen durchsuchte. Ich merkte wie der Schweiß sich auf meiner Stirn bildete. Ich benutzte den Ärmel meiner dunkelgrünen Jacke um ihn wegzuwischen.
Ich fand nichts. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es war, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hatte. Für die Polizei würde es aber wahrscheinlich kein Problem werden, den Mann trotzdem zu identifizieren, denn die Leiche hatte nur leichte Brandwunden.
Ich ließ von dem Toten ab und kniff die Augen zu, während ich meinen Blick durch den Raum wandern ließ um irgendwo den Rockzipfel der Kellnerin zu sehen, wie er aus einem Haufen von Trümmern hing. Beim Umherschauen fiel mir eine Flasche ins Auge, die auf dem Tresen der Bar stand und wie durch ein Wunder dem Inferno entgangen ist.
Ich fühlte das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen.
Ich verlor sofort das Interesse an der Flasche als ich ein Rascheln hörte.
Hinter mir, unter eine Bank gerutscht, lag die bewusstlose Barkeeperin.
Ich griff ihr buchstäblich unter die Arme und half ihr hoch. Sie kam gerade wieder zu sich, als ich sie an die Lehne der Bank anlehnte. Sie sah kurz verwirrt zu mir auf und hielt ihren Kopf mit den Händen fest, als ob er gleich hinweg springen würde.
„Oh, mein Kopf. Nie wieder! jammerte sie.
Nicht nur ich hatte riesige Kopfschmerzen von der Explosion, aber wie ich schien auch die Kellnerin körperlich unbeschadet geblieben zu sein.
Sie sah mich wieder an, während sie ihren Kopf auf eine Hand stützte.
„Wie viel Wodka hab’ ich getrunken? Nein, sag’ es mir lieber nicht! Wie heißt du, Cheri?“ fragte sie mich. Ich dachte, sie wollte mich für Dumm verkaufen, aber man konnte ihre Verwirrtheit nachvollziehen, das war ja auch ein ziemlicher Knall gewesen.
Ich teilte ihr meinen Namen mit, wobei ich darauf achtete, nicht zu laut zu sprechen: „George Stobbart, Ma’am.“
Sie klang etwas überrascht und fragte, ob ich Amerikaner sei.
Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen.
Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben.
Halb als Scherz, halb ernst gemeint, meinte ich: „Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen...“
Sie hängte ihren Satz ohne Pause an meinen an: „Ich könnte einen Drink gebrauchen!“
Ich hatte dieses zierliche, französische Mädchen wohl ein wenig falsch eingeschätzt.
Anscheinend war das zierliche, französische Mädchen eine handfeste Trinkerin.
„Mir ist schlecht, schwindlig, ich fühle mich mies – und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war!“
Ich versuchte sie wieder ein wenig zu beruhigen und hoffte, sie würde bald merken, was eigentlich geschehen war: „Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt.“
„Wie bitte? Was ist passiert?“ fragte sie, wieder die Unschuld in Person.
„Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen.“ riet ich ihr.
Daraufhin fragte sie mich ob ich Arzt sei.
„Nö, aber als Kind hab’ ich immer Krankenhaus gespielt.“ antwortete ich mit einem Grinsen im Gesicht. Das Grinsen verschwand wieder aus meinem Gesicht und ich kam wieder zum Ernst der Lage zurück: „Können Sie sich denn an gar nichts erinnern?“
Und auf einmal verwandelte sich die kleine Französin wieder in die Trinkerin: „Non. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy.“
Ich habe ihr klar gemacht, dass sie einen Schock erlitten hatte, also keinen Alkohol trinken sollte. Ich hatte das Gefühl, dass ihr Kopf so langsam wieder klarer wurde.
„Was ist mit dem alten Mann – ist er tot?“ fragte sie mit einer zitterigen Stimme.
„Natürlich nicht.“
Ich wollte kein hysterisches französisches Mädchen am Hals haben – wenigstens in dem Augenblick nicht. Um sie etwas bei Laune zu halten bis die Polizei eintraf, fragte ich sie aus.
Zuerst fragte ich, ob sie den alten Mann kannte. Sie sagte, dass sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Als nächstes interessierte ich mich dafür, wie sich der alte Mann benahm und sie meinte, er wäre nervös gewesen, schaute sich ständig um – zur Tür, auf die Uhr.
„Als ob er auf jemanden warten würde?“
„Ja, würde ich sagen. Er hatte vor irgendetwas Angst, das ist sicher.“
Sie begann etwas zu flüstern, als ob der Mann sie noch immer hören konnte, na ja, ich hatte sie ja auch in dem Glauben gelassen, er würde noch leben.
„Wenn Sie mich fragen, hatte er eine Affäre. Er hatte diesen schuldbewussten Blick... wie ein Ehemann auf Abwegen.“
Man soll ja eigentlich nicht schlecht über Tote reden...
„Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam?“
„Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Es war die reinste Begräbnismusik.“ sagte sie mit verzogenem Mund.
Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden.
Ich erkundigte mich, ob der Clown mit dem alten Mann gesprochen hatte.
Das Fräulein entgegnete, dass der Clown den Mann nur ausgelacht habe.
„Dann grabschte er sich den Koffer des alten Mannes und rannte raus.“ fuhr sie fort.
„Hat der alte Mann versucht, den Clown zu stoppen?“
„Oh, dazu hatte er überhaupt keine Möglichkeit. Der Clown ließ sein Akkordeon fallen und rannte zur Tür hinaus. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht mehr.“ Ihre Stimme klang immer wehleidiger und ich stellte im Gedanken die Vermutung an, dass das Akkordeon mit einer Bombe versehen war, raffiniert, eigentlich zu raffiniert für einen Clown.
„Haben Sie gesehen, was der alte Mann in seinem Koffer hatte?“ Das interessierte mich brennend. Es musste irgendetwas überaus Wertvolles gewesen sein.
Die Bedienung ließ meine Träume sofort wieder verpuffen. Der Mann hatte den Koffer nicht geöffnet. Ich wollte wissen, was der alte Mann tat, als der Clown sich den Koffer grabschte.
„Nichts. Er saß einfach da, wie erstarrt.“ Sie rief sich wohl das Gesicht des Mannes wieder ins Gesicht, denn sie begann zu weinen und ließ ihren Kopf wieder in ihre Handflächen plumpsen. Sie sollte im Café bleiben, während ich mich draußen nach Beweisen umsehen wollte. Ich kam mir langsam vor wie Sherlock Holmes oder mit ein paar Jahren mehr Columbo. Ich mochte Detektivgeschichten schon immer und langsam, aber sicher packte mich der Ehrgeiz, den Clown hinter Gittern zu sehen und zwar ungeschminkt.
Ich legte meine Hände an meine Hüfte und begann tief ein und auszuatmen, um meinen Denkfluss ein wenig zu erhöhen. Auf dem Bürgersteig war nichts von Interesse.
Ich beschloss, bis die Polizei eintraf, auf eigene Faust den Fluchtweg des Mörders zu verfolgen und als ich gerade einen Schritt auf die Straße getan hatte, fiel mir eine Zeitung auf, die sich um den Laternenpfahl gewickelt hatte. Ich hob die Pariser Tageszeitung auf und schlug zufällig den Leitartikel auf. Er erzählte etwas über den Besuch eines Nobel – Preis – Gewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das war aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest bestand aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Ganz klar eine Zeitung von der Sorte, die ihren Inhalt mit Sex, Skandalen und Sportergebnissen bestreitet. Ich überflog die Seite.
Mir fiel die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Dort stand: ‚Salah – eh Dinn, 13 45’.
Nun, so wirklich etwas anfangen konnte ich damit nicht, also steckte ich mir die Zeitung ein und begab mich in die Gasse, in die ich den Clown hatte flüchten sehen.
Im Großen und Ganzen war die Sackgasse ziemlich verdreckt, die Wände waren fast nackt, überall lag Müll herum, hauptsächlich alte Glasflaschen und marode Kartons.
Zu meiner Rechten befand sich ein Regenrohr an der Hauswand, es sah so aus, als ob es mein Gewicht tragen konnte. Ich holte tief Atem und begann, das Regenrohr hochzuklettern.
Leider klappte dieses Vorhaben nicht denn das Rohr brach ab, als ich nur einmal leicht daran zog. Ich nahm an, dass der Clown über die Dächer getürmt war.
Neben dem Regenrohr war ein Fenster in der Hauswand, geschützt durch solide wirkende Eisenstäbe. Ich rüttelte an den Stäben, um zu sehen, ob der Clown vielleicht durch das Haus geflüchtet war, doch die Stäbe bewegten sich im Gegensatz zu dem Rohr keinen Millimeter.
Diese Möglichkeit konnte ich also wieder ausschließen. Weiter an der Wand entlang standen drei Mülltonnen und dazwischen ein Stapel Kartons, in denen mal Weinflaschen verpackt waren. Die Untersuchung der ersten Mülltonne erbrachte nichts, sie war schlicht und ergreifend leer. Ich untersuchte die Kartons genauer. Sie waren feucht, ziemlich muffig und einwandfrei leer. Nun fokussierte ich mich auf die zweite Tonne.
Als ich sie öffnete stieg mir der Gestank entgegen. Es roch, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte.
Ich knallte den Deckel wieder auf die Tonne, ich wollte mir nicht einmal die ausmalen, was die Quelle des Gestanks war. In der dritten Tonne stank es zwar nicht so höllisch, aber trotzdem habe ich mich höllisch erschrocken, da eine schwarze Katze dort ihr Schläfchen hielt und als ich den Deckel anhob, sprang mir die Straßenkatze entgegen und lief davon.
Ich beschloss nicht weiter im Müll zu graben, aber um mein Missfallen kundzutun, trat ich gegen eine herumliegende, sowieso schon verbeulte Plastikkiste.
Als ich mich gerade wieder umdrehte, um zum Café zurückzukehren, fiel mir eine Eisenplatte im Boden auf, die den Eingang zu einem Kanalisations- oder Abflussrohr versperrte.
Das war noch eine Möglichkeit, der Clown hätte eventuell durch die Kanalisation flüchten können, mit dem richtigen Werkzeug, denn mit den bloßen Händen bekam ich den Gullydeckel nicht auf, da ich keinen guten Angriffspunkt fand.
Enttäuscht begab ich mich auf die Straße zurück, auf der mir vorher eine kleine Baustelle aufgefallen war, in der ein klobiger Mann den Boden mit einer Spitzhacke bearbeitete.
Er musste auch etwas gesehen haben, denn die Baustelle war nicht sehr weit vom Café entfernt. Im Laufschritt ging es hinüber zur Baustelle, die im Eingang in die angrenzende Allee lag. Ich war gerade in die Schatten der Bäume an der Seite der Allee getreten, da kam mir endlich die Polizei entgegen, genauer gesagt war es ein einzelner Gendarm.
Ich wollte ihn gerade begrüßen und auf den Tatort verweisen, als er plötzlich seine Waffe zückte, in die Knie ging und auf mich zielte. Der Gendarm war schon ein wenig älter, graues Haar, dicker Schnauzer, der seinen Mund fast komplett verdeckte.
Er trug die für Frankreich typische Gendarmenuniform in schwarz mit einer schwarzen Kappe auf dem grauen Haupt. Seine Hände waren von weißen Handschuhen umgeben und er hatte goldenes Zeug auf den Schultern, das aussah wie zwei Besen – Enden.
„Stopp! Keine Bewegung!“ rief er mir zu.
Der Bauarbeiter stellte seine Arbeit erst einmal ein, um sich als Schaulustiger zu betätigen.
Ich hob meine Hände und rief: „He – nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner!“
„Können Sie sich nicht für eins entscheiden?“ fragte er in lautem Ton.
Ich verlangte schon mal vorsorglich, mit dem amerikanischen Konsul zu sprechen.
Er ignorierte mein Verlangen und befahl mir, meine Waffen fallen zu lassen und mich auf den Boden zu legen. Nur gut, dass ich Pazifist bin. Hinter dem schießwütigen Polizisten kam ein weiterer Mann hinzu, groß, Glatze, ein Bart, der sich um seinen Mund schloss und dicken Augenbrauen. Er trug einen braunen Mantel, wahrscheinlich aus Leder, darunter ein mit Krawatte versehenes Hemd und eine braune Hose.
An den Füßen trug er zwei bestimmt sehr teure Markenschuhe.
„Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Moué.“ wies er seinem Polizistenkollegen in gebieterischem Ton an.
„Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen.“
Seine Stimme klang nun etwas höflicher und man konnte die hohe Intelligenz des Mannes förmlich heraushören. Ich fragte, noch ziemlich verunsichert und zögerlich, ob ich verhaftet sei. Der große Glatzkopf, wolle mir nur ein paar Fragen stellen, versicherte er mir.
Er befahl mich und den Gendarmen zum Café mit einem: „Marchez!“
Die Kellnerin saß immer noch, am Boden zerstört, auf der Sitzbank in der Ecke und rührte sich nicht, auch als wir hereinkamen. Der Sergeant wand sich als erstes der Leiche zu und der Mann im Mantel blieb bei mir.
„Was für ein Anblick! Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr?“
Ich hatte daran gezweifelt, ob dieser Mann so etwas wie Gefühle hatte, aber zu meiner eigenen Beruhigung bestätigte sich mein Zweifel nicht.
„Hören Sie damit auf, Monsieur!“ Die Stimme des Sergeants.
Der Mann, ich schätze mal er war Inspektor oder Kommissar oder so etwas, und ich drehten uns zu Moué um, der über den Toten gebeugt war.
Und wieder befahl Moué dem Toten: „Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten.“
Der andere Polizist, dessen Namen ich immer noch nicht erfahren hatte, teilte anscheinend meine Verwunderung über die Blindheit des Sergeants: „Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Moué?“
„Oui, Monsieur, aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite?“
Wie hatte dieser Kerl nur die Polizeiausbildung geschafft.
Moué sagte weiter: „Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich tot stellte. Na egal, in diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot.“
Anscheinend kam der Sergeant so langsam wieder auf den Boden der Tatsachen.
Sergeant Moué behauptete, dass es sonnenklar war, dass der Killer von der Anwesenheit des Opfers wusste, doch der andere Polizist warnte ihn davor, voreilige Thesen aufzustellen.
Alles, was sie sicher wüssten war, dass der Mann tot war. Da hatte er nicht so ganz Unrecht.
„Ich fand es war logisch, anzunehmen, dass...“ begann Moué und der Glatzkopf unterbrach ihn: „Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel...“
Ich hatte nicht den geringsten Schimmer, wer das war, aber Moué verriet es: „A... aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder Der Alte.“
„Das ist was anderes, Moué – die brauchten ja auch Assistenten.“ Ich hatte den glatzköpfigen Mann wohl doch für etwas intelligenter gehalten, als er tatsächlich war.
„Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen.“ ordnete der Polizist seinem Kollegen an, der sich umgehend daran machte, den Befehl zu befolgen.
„Et maintenant, zum Geschäft.“ Der Mann konzentrierte sich wieder auf mich.
Er kramte in einer Innentasche seines Mantels, aus der er Stift und Notizblock hervorholte.
Er fragte nach meinem Namen, den ich ihm sagte, mit der Bemerkung, dass ich aus Kalifornien komme, falls er danach auch noch fragen wollte.
Der Polizist wollte wissen, was mich nach Paris führte. Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass ich durch Europa reise und er beglückwünschte meine Wahl, da die Stadt zu der Jahreszeit am schönsten war.
„Äh... ja, könnte sein – von den Bomben einmal abgesehen.“ bemerkte ich schnippisch, was mein gutes Recht war, meiner Meinung nach.
„Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging?“
Ich bejahte und sagte, dass ich draußen auf dem Bürgersteig saß.
„Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat!“
Der wohlmögliche Inspektor ignorierte meine Bemerkung komplett und fragte, ob ich gesehen habe, wie der Verstorbene das Café betrat.
„Ja, hab’ ich gesehen.“
„War er allein?“
Ich antwortete knapp mit Ja.
Er erkundigte sich, ob der Mann mit mir sprach und ich sagte: „Nein. Die Kellnerin interessierte ihn viel mehr.“ Was gar nicht so weit hergeholt war, so wie er das Mädchen angesehen hatte.
Mein Gegenüber notierte weiterhin alles auf seinem Block und wollte wissen, ob ich jemand anders in das Café habe gehen sehen. Ich erzählte ihm von dem Typen, der wie ein Clown gekleidet war und ein Akkordeon trug.
„Ein Akkordeon? Bon. Das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch.“
Er steckte seine Schreibsachen wieder zurück und fragte Sergeant Moué, ob das Mädchen in Ordnung sei. Die beiden zogen sich zu einer kurzen Lagebesprechung zurück.
„Sie wird’s überleben. Sie bestätigt die Aussage des Amerikaners. Ein Clown mit einem Akkordeon, zweifellos eine raffinierte und exzentrische Verkleidung.“ flüsterte Moué seinem Vorgesetzten zu.
„Sehr gut.“ sagte er zu Moué und wand sich wieder mir zu: „Eh bien. Ich habe genug gehört.“
Ich wollte wissen, was er damit meinte und er sagte mir, dass er überzeugt war, dass ich nichts wusste und ich gehen könnte.
„Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs.“
Damit wollte ich mich nicht zufrieden geben: „Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben?“
„Was soll ich sagen? Passen sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren...“
Moué hatte auch noch einen Ratschlag für mich: „Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen.“
Ich bedankte mich freundlich für diesen famosen Ratschlag: „Toller Tip.“
Der Polizist war davon überzeugt, dass ich mich nicht im Geringsten in Gefahr befand.
Falls mir noch etwas Wichtiges einfiel, sollte ich ihn anrufen. Er gab mir seine Visitenkarte.
Ich sah sie mir kurz an, darauf stand: ‚Augustin Rosso, Inspecteur de police’.
Er wohnte südlich des Friedhofs von Montparnasse.
Ich ließ die Karte in einer Innentasche meiner Jacke verschwinden und bedankte mich.
„Das wäre alles. Sie können gehen.“ Damit schickte er mich gen Ausgang, doch in der Tür hielt ich einen Moment inne, um dem Gespräch der beiden Polizisten zu lauschen.
„Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur.“
„Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte.“ Der Inspektor hatte anscheinend ein Fable für das Übersinnliche.
„Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch.“ so Moué.
„Akademisch?“ fragte Rosso. „Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden!“ Inspektor Rosso legte seine Hand in Denkerposition an seinen Kopf und beendete damit die Konversation. Als ich wieder auf dem Bürgersteig war, fiel mir eine Frau ins Auge, die den Tatort fotografierte. Sie hatte schwarzes Haar, eine feminine Lederjacke und darunter ein violettes Minikleid an. Dort wo das Kleid aufhörte, begann die schwarze Strumpfhose für das Auge sichtbar zu sein. Die Strumpfhose mündete in blaue Pumps. Ein extravaganter Aufzug, dennoch sehr anziehend. Ihre Kamera hing der jungen Frau um den Hals und weil ich nun mal keine Gelegenheit auslasse, sprach ich sie an: „Verzeihung, Mademoiselle!“ Sie drehte sich zu mir um und ich trat näher an sie heran.
Ich stellte mich vor und sie vermutete aufgrund meiner Sprechweise, dass ich Amerikaner war. Ich bestätigte ihre Vermutung und erwähnte, dass ich auf Urlaub in Paris sei.
„Schöner Urlaub, was?“
Sie fragte: „Du warst hier, als die Bombe hochging?“ Auf einmal hörte sie sich sehr interessiert an.
„So ist es! Ich habe genau vor dem Café gesessen.“
„Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel?“
Ich konnte es nicht glauben, sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühlte, aber ich ließ es ihr einfach durchgehen und berichtete: „Ja. Kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht... mit ihm verwandt?“
„Oh, nein – nichts dergleichen.“ Das beruhigte mich sehr denn ich hatte keine Lust einer schönen Französin zu erklären, dass einer ihrer Angehörigen tot war.
Sie stellte sich vor: „Ich bin Nicole Collard, von ‚La Liberté’.“
„Was ist das – ein Nachtclub?“ fragte ich unbeholfen.
Ich trat mal wieder ins Fettnäpfchen: „Ah, nein – es ist eine Tageszeitung.“
„Du bist Reporterin?“ fragte ich interessiert.
Sie sagte mir, dass sie freie Fotojournalistin sei und ich schlug ihr daraufhin vor, mich über den Bombenanschlag zu interviewen.
„Ein Augenzeugenbericht... Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du – Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme – so was in der Art.“
Ich sah mich schon auf dem Titelblatt aller Zeitungen, derjenige der das Inferno überlebte...
„Ich bleibe bei den Tatsachen, danke.“ Damit zerstörte sie meinen schönen Traum.
„Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat?“
Auf die Gefahr hin, dass sie mich für dumm verkaufen würde, erzählte ich ihr von dem als Clown verkleideten Typen.
Sie war geschockt und in ihrer Stimme und ihrem Gesicht spiegelte sich blankes Entsetzen wider: „Oh Gott! Er hat wieder zugeschlagen...“
Auch ich kam in helle Aufregung, jedenfalls innerlich. Ich fragte Nicole, ob sie den Clown jemals zuvor gesehen hatte.
„Das ist...“ sie zögerte und sprach dann weiter: „... eine lange Geschichte.“
„Ich habe viel Zeit.“
„Ich nicht.“ Ich beließ es vorerst dabei, vorerst, und fragte sie über den Mann aus: „Wer war der Typ, den du treffen wolltest?“
„Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten.“ Sie seufzte, wie ein kleines Mädchen, dass nicht das bekommt, was es will und fuhr fort: „Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte.“
„Es sei denn, du hättest Rossos Gabe der parapsychologischen Befragung.“ Der Witz landete nicht und ich hakte weiter nach: „Woher hat Plantard deinen Namen?“
„Über die Zeitung – ‚La Liberté’. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe, einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich: Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen.“
Beinah hätte ich vergessen zuzuhören, denn ich achtete die ganze Zeit auf ihren schönen, vollen Mund, der sich so geschmeidig bewegte, wenn sie sprach, aber ich bekam Gott sei dank noch die Kurve. Ich kam wieder auf den Clown zurück: „Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen?“
„Warum möchtest du dich da einmischen?“
Was für eine dumme Frage: „Weil er mich fast getötet hätte! Ist das nicht Grund genug?“
Sie kam zur Einsicht: „Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal...“
Sie kramte in ihrer Jackentasche und holte einen zusammengeknüllten Briefumschlag und einen Stift heraus.
„Ich gebe dir meine Telefonnummer.“
Sie gab mir den Umschlag mit der Nummer und sagte: „Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vorneherein klar ist: Das ist rein geschäftlich.“
Das musste ja kommen, aber: „Okay. Abgemacht.“
Damit verabschiedete sie sich: „Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. À bientôt, Monsieur.“
„Gut. Ich, uh... bis bald.“ Trotz allem was bisher passiert war, hatte ich doch wenigstens die Telefonnummer einer echt heißen Französin, die zwar selbstsicher tut, aber hinter dieser Maske eher bockig wirkt, ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Aber haben wir nicht alle unserer kleinen Macken?
Da zog sie von dannen. Ich sah ihr noch einen Moment hinterher und ging dann zu Sergeant Moué rüber, der den Eingang des Cafés bewachte, indem er sich mitten hinein stellte.
Der Sergeant war ein mickriger Mann, der auf gewisse Art einem kopflosen Huhn glich.
„Entschuldigen Sie, Sergeant.“
Er wollte mich sofort wieder abwimmeln: „Sie haben den Inspektor gehört. Gehen Sie nach Haus, Monsieur.“
So schnell ließ ich mich aber nicht vertreiben: „Haben Sie nicht vor, nach dem Mörder zu fahnden, Sergeant?“
„Nein, mein Herr. Der Inspecteur hat mir ausdrückliche Anweisung gegeben, diese Türe zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck.“ entgegnete er mir mit seinem überaus starken Akzent.
„Ich habe gesehen, wie der Clown in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt ist.“
Moué fragte mich, ob ich dem Clown gefolgt bin und ich sagte, dass keine Spur mehr von ihm zu sehen war, als ich in die Gasse ging. Ich erklärte ihm auch meine beiden Vermutungen über den Fluchtweg des Clowns, die Dächer und die Kanalisation, obwohl es mir viel wahrscheinlicher erschien, dass der Mörder durch die Kanalisation geflüchtet war.
„Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt?“ fragte er mich, obwohl er die Antwort sicher wusste.
„Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben.“ scherzte ich. Sergeant Moué versuchte immer noch mich zu abzuwimmeln, indem er mir versicherte, dass Inspektor Rosso eine vernünftige Suche organisieren würde.
„Wie konnten Sie und Rosso so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion! Hatten Sie einen Tipp bekommen?“ wollte ich wissen.
„Diese Informationsquellen von Inspecteur Rosso sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur.“
Während der Sergeant mit mir redete, schaute er immer wieder ins Café, wahrscheinlich wollte er nicht, dass Rosso ihn mit mir reden sieht. Dann, als er sich sicher war, dass Rosso beschäftigt war, schwenkte er seinen Kopf näher zu mir und flüsterte: „Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen.“
Ich fragte ihn, was er glaubte und er flüsterte noch leiser, fast in einem Hauchen: „Ich glaube, er ist selbst der Teufel.“
„Was macht Rosso mit dem Mädchen?“ fragte ich, als ich einen Blick an Moués Schulter vorbei warf und sah, wie Rosso auch mit der Kellnerin sprach.
„Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet.“
„Bitte?“
„Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab.“ verriet mir Sergeant Moué.
Ich fragte ihn über die Sache mit dem Übersinnlichen: „War das sein Ernst mit dem ganzen Psycho – Polizisten – Kram?“
„Natürlich! Inspecteur Rosso ist ein Pionier und Visionär! Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln!“ Ich hatte so leicht das Gefühl, dass man die Beziehung der beiden Polizisten zueinander mit dem Guru und seinem Anhänger vergleichen konnte.
„Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass so was in L. A. klappt.“ dachte ich laut.
Um das Gespräch auf Plantard, den Toten, zu lenken, erzählte ich dem Sergeant von den Gedanken, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf gingen: „Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant.“
„Haben Sie damit irgendein Problem?“
Damit bewies Sergeant Moué erneut, dass es ihm ausnahmslos an Feingefühl fehlte, aber wenigstens war das Gespräch nun auf den Toten gerichtet.
„Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen.“
Ich bekam die Antwort, die ich in diesem Augenblick von jedem Polizisten erwartete: „Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur.“
Moué fragte jedoch auch noch, ob das Opfer mit mir gesprochen hatte.
Plantard hatte mir nur zugenickt, mehr nicht.
„Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit.“
Wie konnte ich das vergessen, schließlich wäre ich um ein Haar selber hopsgegangen.
Nach kurzem Überlegen, teilte ich Sergeant Moué den Namen des Opfers mit und er fragte hellhörig, ob ich das Opfer also doch kannte.
„Nein, aber...“
Moué unterbrach mich zu meiner Verwunderung: „Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt.“
„Ich versuche nur, Ihnen zu helfen!“ beteuerte ich.
„Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur.“
Ich konnte es nicht glauben, Sergeant Moué war es wichtiger, seine Ruhe vor mir zu haben, als etwas über den Fall in Erfahrung zu bringen. Ich ließ mich jedoch noch nicht völlig entmutigen und zeigte ihm die Zeitung, die ich gefunden hatte.
„Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf – ‚Salah – eh Dinn, 13 45’.“
Meine Anregung mit der Zeitung fruchtete sogar denn ich brachte Moué wenigstens ein wenig ins Grübeln: „Ah! Also war das Treffen mit dem Clown geplant!“
„Wie kommen Sie denn darauf?“ Ich befürchtete, der Sergeant verfehlte die Tatsachen ein wenig bei seinen Vermutungen.
„Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen halb Zwei und Zwei, n’est – ce pas?“
„Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen?“
Es schien zuerst, als ob der Gendarm einen Geistesblitz hätte, doch anscheinend war es nur ein Funke.
„Das wirft Sie aus dem Sattel, was?“
„Ich bin noch niemals in meinem Leben – wie Sie es auszudrücken belieben – aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur.“ Er war wohl ein wenig beleidigt, obwohl meine Frage nicht beleidigend sein sollte.
Moué sprach seine Vermutung aus: „Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, non?“
„Salah – eh Dinn, der Clown? Das glaube ich weniger.“
Ich konnte erkennen, dass es dem Sergeant nicht gefiel, wie ich seine Mutmaßungen entkräftete, also verabschiedete ich mich, bevor ich noch wegen einem unersichtlichen Grund verhaftet werden würde. Mein nächstes Vorhaben bestand darin, den Bauarbeiter an der Straßenecke zu befragen und von irgendwo her ein Werkzeug zu bekommen mit dem ich den Kanalisationsdeckel aufhebeln konnte. Die kleine Baustelle oder besser gesagt Baugrube lag direkt auf dem Bürgersteig an einer Hauswand mit einem großen Holztor.
Der muskulöse Straßenarbeiter, schon ein älterer Kerl und wahrscheinlich ein paar Jahre vor dem Ruhestand, trug eine Miene zur Schau, die auf fünf Meter Entfernung deutlich besagte: Lass mich in Ruhe, ich habe zu tun! Natürlich war mir das völlig egal.
Neben der kleinen Grube, in der der Mann mit einer Spitzhacke herumhantierte, stand ein aus Plastikplanen bestehendes Zelt, in dem nur ein großer zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall stand. Neben dem Zelt lag ein großes Bauarbeiter – Telefon, das verdammt schwer aussah.
„Hi! Hätten Sie mal eine Sekunde Zeit?“ fragte ich den Arbeiter und hoffte nicht seine Hacke abzubekommen. Er hörte auf, den Boden zu malträtieren und sah mich aus seinen tiefen Augenhöhlen grimmig an: „Ich dachte, Sie wären im Knast...“
Ich teilte ihm mit, dass das nur ein Missverständnis war.
„Als der die Knarre rausholte – boah – ich dachte, das war’s.“
Der Typ war keinesfalls so, wie man sich einen Franzosen vorstellte, aber das Klischee vom feinfühligen Charmeur war sowieso veraltet.
„So ne Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie.“ berichtete er mir.
„Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist.“
„Sie? Ein Terrorist? Ha!“ So unschuldig sehe ich doch nun wirklich nicht aus.
Gut, ich bin kein Dirty Harry, aber eine gewisse Verwegenheit kann mir doch wohl nicht absprechen.
„Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt.“ sagte ich und versuchte, mich nicht beleidigt zu fühlen.
Ich begann meine Befragung damit, zu fragen, ob er einen älteren Herrn mit Koffer gesehen hatte.
„Oui. So ‘n alter Blödmann! Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können!“ Er streichelte den Stiel seiner Hacke mit seinen dreckigen Handschuhen.
Sein ehemals weißes Hemd hatte er an den Armen hochgekrempelt. Der Bauarbeiter war zwar ein wenig dick, trotzdem sehr muskulös, was wohl einerseits vom reichhaltigen französischen Essen und andererseits von der Bauarbeit herrührte.
„Haben Sie den alten Mann erkannt?“ wollte ich wissen und er sagte Nein.
Er fragte, ob er den Mann erkennen sollte und ob er berühmt war.
„Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard.“
„Was soll das heißen? Ist er tot?“
Erfasst und auf einmal wandelte sich seine Rauheit in Mitgefühl um, was mich sehr verwunderte, positiv.
„Jetzt tut’s mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe.“ Er übertrieb es jedoch ein wenig.
„Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen! Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen!“
Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern.
Zu schlechten meistens. Ich lenkte das Gespräch auf den Mörder und fragte den Mann, ob ein Clown an seinem Arbeitsplatz vorbeigekommen wäre.
„Ein Clown? Wie im Zirkus?“
„Ja. Voll geschminkt und mit einer großen roten Nase.“
„Ho! Die Typen sind witzig, ey?“
„Hab ich andere Erfahrungen gemacht.“
„Ich mag den Zirkus – besonders die Pferde.“
Er hatte meine Frage noch nicht beantwortet, also fragte ich nochmals, ob er einen Clown gesehen hatte.
„Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen.“
Und das sagte er ausgerechnet mir, schließlich bin ich Anwalt.
„Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen.“
„Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen – ich hab nix und niemanden gesehen.
Ich wagte noch einen Versuch: „Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make – Up!“
„Wär ‘n komischer Clown, wenn’s anders wär’...“
Langsam ging meine Geduld wirklich zu Ende: „Hören Sie – ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer.“
„Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Bulle?“ fragte er so abwertend, dass es nur Absicht sein konnte.
„Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus?“
„Vermutlich nicht. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen?“ Langsam aber sicher zweifelte ich an dem menschlichen Verstand einiger Leute in Paris.
„Was, haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen.“ berichtete ich dem Unwissenden.
„Der Clown hat den alten Mann umgebracht?“
„Genau. Hat ihn mit einer Bombe weggepustet, die in seiner Quetschkommode versteckt war.“
„Merde! Aber warum hat er sich als Clown verkleidet?“
„Wer weiß schon, was im Kopf von so einem Killer vor sich geht? Ich nehme an, der hat irgendein tief sitzendes psychologisches Problem – oder er will einfach nur auffallen.“ vermutete ich.
Die Sache hatte keinen Sinn, der Kerl hatte nichts gesehen, aber ich kam auf die glorreiche Idee in seiner Werkzeugkiste nach einem geeigneten Kanaldeckel – Aufmach – Dingens zu suchen, doch der rabiate Bursche vereitelte meinen Plan: „He, nix da! Hauen Sie schon ab!
Was denken Sie sich eigentlich?“ schnauzte er mich an.
„Ich habe... Ihren Werkzeugkasten bewundert.“ log ich ihm frech ins Gesicht.
„Ah, oui? Genug gesehen jetzt? Ich warne Sie – wenn Sie die Kiste anfassen, ramme ich Ihnen die Zähne ins Gehirn.“
„Okay! Ich hab schon kapiert.“ Das stimmte zwar, aber Aufgeben wollte ich noch nicht.
„Hey!“ rief ich so nett man Hey rufen konnte.
„Was wollen Sie denn diesmal?“ fragte er, sichtlich genervt.
Ich bot ihm meine Zeitung an, doch er sträubte sich: „Zum Lesen hab’ ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin?“
Ich schlug ihm vor: „Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen.“
„Ich hab’ gerade mal zehn Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das.
Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste.“
Jetzt reichte es mir allmählich, ich startete den Frontalangriff: „Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei.“
Es klappte. Grummelnd griff er sich die Zeitung und überflog kommentierend die Artikel: „Pah! Es ist unglaublich! Diese verdammten weichherzigen Liberalen! Pfft! Die Delphine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung! So ein Theater wegen ein paar Fischen!“
Jetzt wusste ich auch, warum dieser Kerl Bauarbeiter und nicht etwa Biologe geworden war.
„Oha, das ist schon besser! Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß! Wie Sektkorken, non?“ Ich hoffte, er sprach von dem Seite – Drei – Mädchen.
„Ah. Was ist denn das? Salah – eh Dinn – läuft beim Großen Preis vom Arc de Triomphe!“
„Ist das ein Rennpferd?“ fragte ich unwissend.
„Ein Pferd?“ Er hörte sich nun an wie ein brasilianischer Fußballkommentator: „Eine Legende, mon ami! Schnell wie der Blitz ist sie!“
Er kroch aus seiner Grube und ich war mir nicht sicher, was er nun anstellen wollte.
„Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen!“
Geschafft! Mein Plan war tatsächlich aufgegangen.
„Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten?“
„Vergiss es, Kumpel! Bedien dich!“ Und damit marschierte er davon, bereit all sein Geld zu verzocken, aber ich hatte mein Ziel erreicht und hoffte, dass der Werkzeugkasten auch das richtige Werkzeug enthielt denn sonst wäre alles umsonst gewesen, die ganze angewandte Überredungskunst. Ich schmiss mich auf die Kiste wie ein hungriger Wolf auf seine hilflose Beute und tatsächlich, ich fand genau das, was ich brauchte – ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln konnte. Es war ein Metallstab mit einem Griff am einen und einer kurzen Querstrebe am anderen Ende.